Digitaler Produktpass: “Für echte Transparenz sorgen”
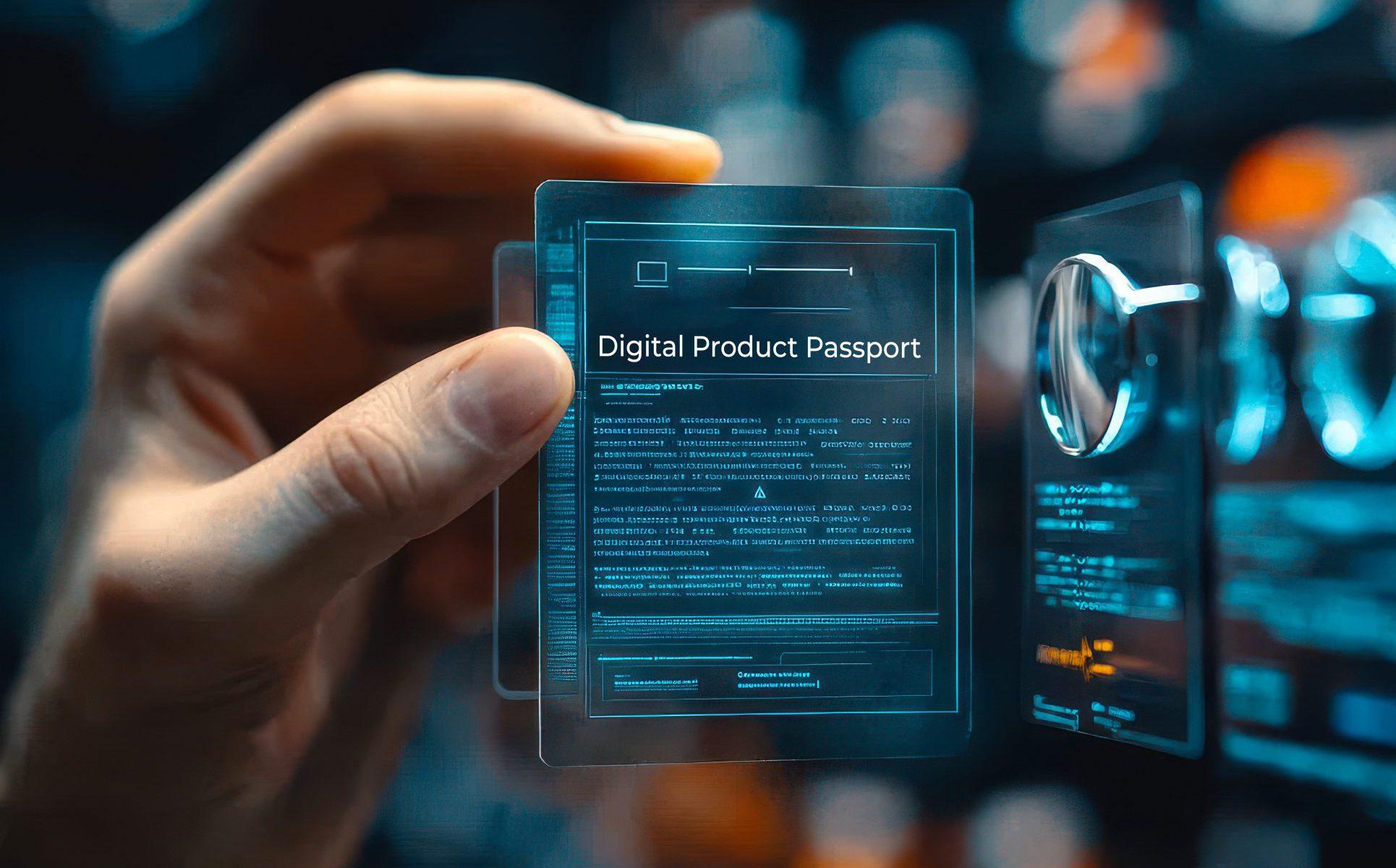
18. April 2025
Michael Fälbl von der Plattform Industrie 4.0 über Potenzial und Herausforderungen eines zukunftsweisenden Konzepts.
Der Digitale Produktpass (DPP) ist ein zentrales Element zukünftiger Kreislaufwirtschaftsmodelle. Er ermöglicht eine durchgängige Dokumentation über den gesamten Produktlebenszyklus – vom Design über Produktion, Nutzung bis hin zu Rücknahme und Wiederverwertung. Technologien wie Künstliche Intelligenz, Blockchain und Big Data sind dabei treibende Kräfte, die nicht nur Transparenz schaffen, sondern auch Prozesse effizienter und nachhaltiger gestalten.
Am 28. April versammelt unser Start me up Monday zu diesem Thema Startups und Expert*innen. Im Vorfeld der Veranstaltung haben wir mit Michael Fälbl von der Plattform Industrie 4.0, einem der Speaker und mit Nikolas Angel (Researcher / Lecturer FH Technikum Wien) über das Potenzial und die Herausforderungen des Digitalen Produktpasses gesprochen.
Inwiefern kann der Digitale Produktpass den Übergang von einer linearen zu einer zirkulären Wirtschaft beschleunigen?
Michael Fälbl: „Möchte man etwa einen Elektronik-Artikel generalüberholen, Komponenten wiederverwenden oder recyceln, dann muss man die genauen Eigenschaften des Produkts kennen. Der Digitale Produktpass soll ein digitales Abbild des Produkts mit relevanten Daten langfristig verfügbar machen – und so eine Lücke in der Kreislaufwirtschaft schließen.“
Wie kann der DPP auch für Konsument*innen einen Mehrwert schaffen?
Michael Fälbl: „Heute dominieren Marketingbotschaften den Informationsfluss. Der DPP kann hier für echte Transparenz sorgen: Welche Materialien sind enthalten? Wie CO₂-intensiv war die Produktion? Diese Vergleichbarkeit bietet nicht nur Konsument*innen Vorteile, sondern auch Unternehmen, die Nachhaltigkeit ernst nehmen.“
Wo liegen die größten Herausforderungen bei der Umsetzung?
Michael Fälbl: „Der DPP darf kein zusätzlicher Bürokratiemonolith werden. Im Idealfall vereinfacht er bestehende Berichts- und Dokumentationspflichten. Und: Es braucht einheitliche Rechtsdurchsetzung in Europa, damit alle Beteiligten gleiche Rahmenbedingungen haben.“
Wie kann ein Digitaler Produktpass (DPP) die Zusammenarbeit zwischen Herstellern, Recyclern und Konsument*innen verbessern?
Nikolaus Angel: Ein Digitaler Produktpass macht den gesamten Lebenszyklus eines Erzeugnisses transparent – von der Herkunft der Rohstoffe über die verwendeten Komponenten bis hin zu Wartungs‑ und Recyclinginformationen. Diese nachvollziehbare Datengrundlage sorgt dafür, dass alle Beteiligten dieselbe „Sprache“ sprechen: Hersteller können ihre Produkte kreislauffähig konzipieren, genauer planen, wann Bauteile zurückgenommen oder aufgearbeitet werden müssen, und dadurch neue Geschäftsmodelle wie Inzahlungnahme‑ oder Pay‑per‑Use‑Konzepte etablieren. Recycler erhalten frühzeitigen Zugriff auf präzise Material- und Demontagehinweise und können so hochwertige Sekundärrohstoffe bereitstellen. Konsument*innen wiederum gewinnen Vertrauen, weil sie belastbare Angaben zu Herkunft, Reparierbarkeit und ökologischer Gesamtbilanz erhalten und dadurch informierte Kauf‑ oder Nutzungsentscheidungen treffen können. Die gewachsene Transparenz senkt also nicht nur Koordinationsaufwand und Missverständnisse zwischen den Stakeholdern, sondern eröffnet zugleich wirtschaftliche Potenziale, von denen letztlich alle Akteursgruppen profitieren.
Wo liegen die größten Herausforderungen bei der Umsetzung eines DPP in der Praxis?
Nikolaus Angel: Die Einführung eines Digitalen Produktpasses verlangt ein gleichzeitiges Zusammenspiel technischer, rechtlicher und organisatorischer Veränderungen. Auf technischer Ebene müssen heterogene IT‑Landschaften, Maschinenparks und Datenformate harmonisiert sowie durchgängige Schnittstellen geschaffen werden, ohne Kompromisse bei Cyber‑Security und Datenintegrität einzugehen. Parallel dazu gilt es, rechtliche Fragen nach Datenhoheit, Wettbewerbs‑ und Datenschutz zu klären – eine Aufgabe, die insbesondere bei international verzweigten Lieferketten komplex wird und durch künftige EU‑Regulierungen wie die Ecodesign‑Verordnung weiter an Dynamik gewinnt. Schließlich erfordert die organisatorische Dimension, interne Silos aufzubrechen, Verantwortlichkeiten neu zu definieren und Mitarbeitende zu befähigen, damit relevante Informationen vollständig, aktuell und qualitätsgesichert in den Pass einfließen. Unternehmen mit globalen Wertschöpfungsnetzen stehen somit vor der Herausforderung, diese drei Ebenen parallel auszubalancieren, ohne ihr Tagesgeschäft zu gefährden.
Welche Entwicklungen könnten in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Kreislaufwirtschaft entscheidend prägen?
Nikolaus Angel: In den kommenden Jahren wird die Kreislaufwirtschaft von einem Zusammenspiel politischer, technologischer und marktseitiger Impulse geprägt sein. Auf regulatorischer Seite zementieren die EU‑Ecodesign‑Verordnung mit dem obligatorischen Digitalen Produktpass und das „Right to Repair“ den Übergang von freiwilligen zu verpflichtenden Zirkularitäts‑Standards, während erweiterte Herstellerverantwortung neue Produktgruppen erfassen wird. Dazu setzen sich Geschäftsmodelle wie Product‑as‑a‑Service, Abo‑ und Pay‑per‑Use‑Konzepte oder großskalige Refurbishment‑Plattformen durch, weil sie die Wirtschaftlichkeit zirkulärer Strategien unmittelbar belegen. Auch die Beschaffungslogik wandelt sich: Unternehmen werden stärker auf regionale Sekundärrohstoffe, „Urban Mining“ und diversifizierte Lieferquellen setzen, um geopolitische Risiken zu reduzieren und ihre CO₂‑Bilanz zu verbessern. Nicht zuletzt wächst der gesellschaftliche und finanzielle Druck: Konsument*innen honorieren Transparenz und Reparierbarkeit immer stärker, und Kapitalmärkte knüpfen Investitionen zunehmend an belastbare ESG‑Nachweise. Zusammengenommen wirken diese Entwicklungen als Katalysator dafür, dass Produkte künftiger Generationen von Beginn an kreislaufgerecht entworfen, genutzt und wieder in Wert gesetzt werden.
Programm und Infos zum Start me up Monday: