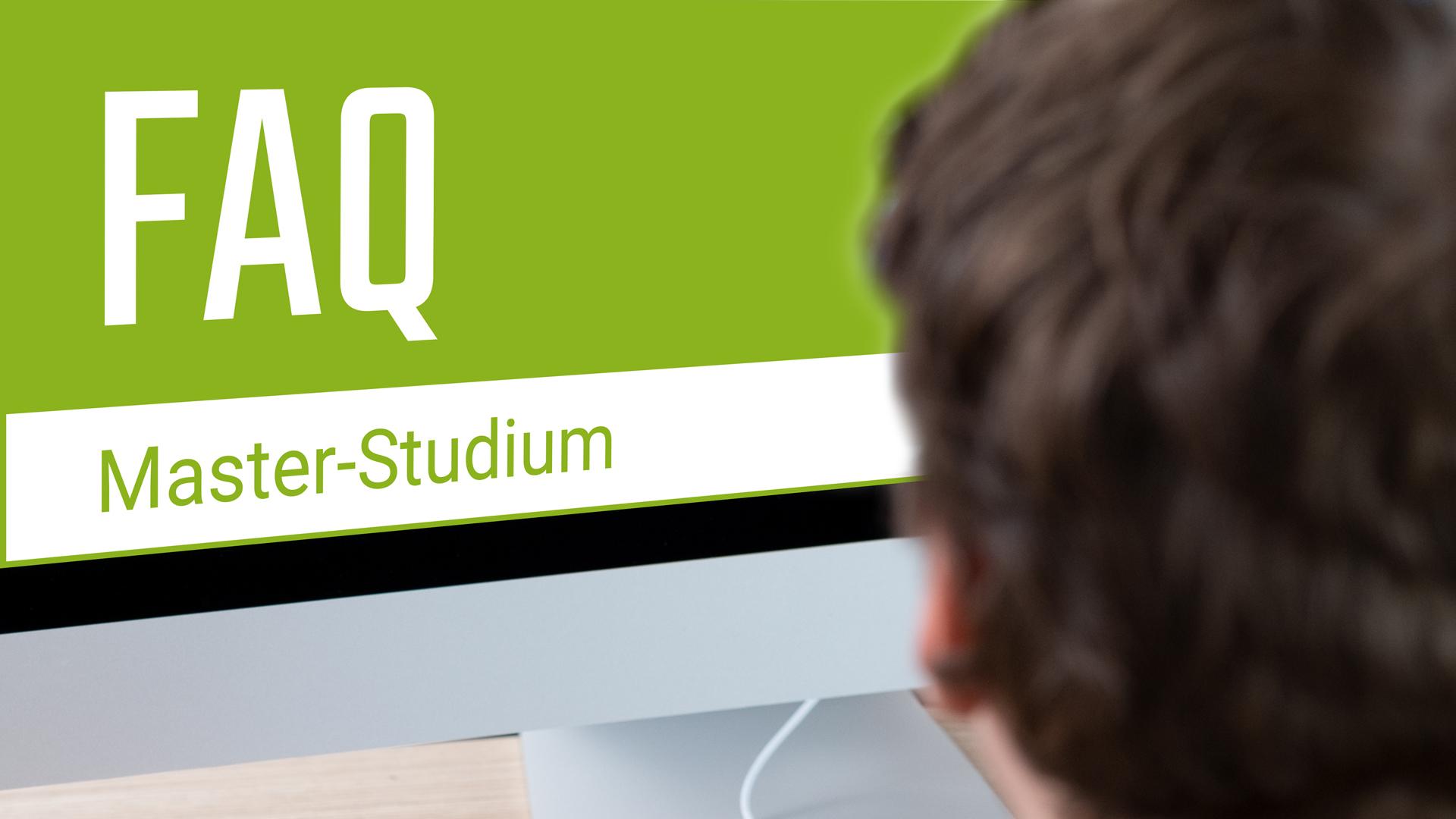Was tun bei Prüfungsangst? Strategien und Tipps für einen konstruktiven Umgang
Prüfungsangst ist unter Studierenden weit verbreitet. Sie geht häufig mit Leistungsdruck, Versagensängsten und dem Gefühl der Überforderung einher. Entscheidend ist einen konstruktiven und gesunden Umgang mit der Prüfungsangst zu entwickeln. Wie sich Prüfungsangst äußert, welche Ursachen sie haben kann und welche kurzfristigen sowie langfristigen Strategien möglicherweise helfen, zeigen wir im folgenden Beitrag.

Definition und Grundlagen– Was ist Prüfungsangst?
Prüfungsangst beschreibt eine spezifische Form der Angst, die im Zusammenhang mit einer konkreten Leistungssituation aufritt. Die betroffene Person empfindet diese Situation als beispielsweise bedrohlich und antizipiert möglicherweise, die Anforderungen der Prüfung nicht erfüllen zu können. Die Angst kann verschiedene Ursachen haben. Sie gehört zur Gruppe der sogenannten Leistungsängste. Typisch ist der Bezug zu bewertenden Situationen, etwa Studienprüfungen oder mündlichen Tests. Neben unzureichender Vorbereitung gilt Prüfungsangst als einer der häufigsten Gründe für Prüfungsversagen. Nicht zuletzt melden sich viele Betroffene daher erst gar nicht zur Prüfung an.
Warum Prüfungsangst im Studium keine Seltenheit ist
Ein Angstzustand ist eine körperliche Reaktion auf eine als bedrohlich empfundene Situation – im Fall der Prüfungsangst also die Prüfung selbst. Entscheidend ist jedoch nicht die Prüfung an sich, sondern wie sie bewertet wird. Studierende stehen unter Leistungsdruck.
Prüfungsangst tritt selten isoliert auf, sondern ist eng mit anderen Faktoren verknüpft. Beispielsweise Dauerhafter Stress, Zeitdruck, fehlende Lernstruktur und ausgelassene Erholungspausen verstärken oft das Gefühl der Überforderung. Auch die mentale Gesundheit und frühere belastende Erfahrungen können möglichweise eine Rolle spielen.
Zudem beeinflusst das Selbstbild das Erleben von Prüfungsangst maßgeblich. Wer sich selbst ständig infrage stellt oder negativ bewertet, ist deutlich anfälliger. In der Psychologie spricht man hier von negativer Selbstattribution: Die Neigung, Misserfolge allein der eigenen Unfähigkeit zuzuschreiben, ohne äußere Umstände zu berücksichtigen.
Ursachen der Prüfungsangst – Leistungsdruck, Perfektionismus und negative Lernerfahrungen
Leistungsdruck, Angst vor Versagen und hohe Erwartungen: Die Angst vor Prüfungen entsteht oft als Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels mehrerer Faktoren. Dazu zählen vor allem innere Einstellung, aber auch frühere Erfahrungen und äußere Erwartungen. Hier ein paar Beispiele:
- Innere Einstellung:
- Perfektionismus: Studierende mit sehr hohen oder überhöhten Ansprüchen zu Spitzenleistungen leiden besonders oft zu Prüfungsängsten. Kleinste Fehler werden als persönliches Versagen bewertet.
- Selbstzweifel und Pessimismus: Studierende mit ausgeprägten Selbstzweifeln erleben Prüfungssituationen als bedrohlich, weil sie wenig Vertrauen in die eigene Kompetenz haben. Sie fokussieren sich nicht auf den Erfolg, sondern auf die Angst vor dem Scheitern.
- Negative Selbstattribution: Menschen mit Prüfungsangst führen Misserfolge häufig ausschließlich auf eigene Fähigkeiten zurück. Statt äußere Umstände zu berücksichtigen, verstärkt ein negatives Selbstbild das Stressempfinden in Prüfungssituationen.
- Frühere Erfahrungen: Frühere Misserfolge in Prüfungssituationen – etwa eine nicht bestandene Prüfung oder Blackout – können sich tief einprägen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit untergraben.
- Äußere Einflüsse:
- Leistungsdruck: Das heutige Studiensystem mit vielen Prüfungen in kurzer Zeit kann belastend wirken.
- Erwartungen von außen: Familie, Arbeitgeber oder Mitstudierende üben, bewusst oder unbewusst, zusätzlichen Druck aus, die das Gefühl verstärken können, unbedingt bestehen oder besonders gut abschneiden zu müssen.
- Rahmenbedingungen: Studienbedingungen, Zeitdruck und fehlende Pausen können Prüfungsängste zusätzlich verschärfen.
Symptome der Prüfungsangst – Körperliche, kognitive und emotionale Anzeichen
Prüfungsangst betrifft nicht nur das Denken, sondern zeigt sich oft ganzheitlich – körperlich, geistig und emotional. Sämtliche Symptome sind Ausdruck eines biologischen Stressmechanismus. Der Körper schaltet in den Alarmmodus und drängt zu Flucht- oder Kampfreaktion. Dabei wird Energie im Körper mobilisiert, während das rationale Denken zeitweise blockiert sein kann (beispielsweise bei Blackouts). Viele Betroffene erleben diese Anzeichen nicht nur während der Prüfung selbst, sondern bereits in der Vorbereitungszeit, oft über Tage hinweg.
Körperliche Symptome
Diese Symptome treten oft schon vor der Prüfung auf, etwa beim Gedanken an den bevorstehenden Termin, und können sich in der konkreten Situation verstärken. Typisch sind:
- Herzrasen, der Puls beschleunigt sich durch die innere Anspannung.
- Zittern, als Reaktion auf Stress und Nervosität.
- Übelkeit oder Magen-Darm-Beschwerden, da der Magen oft sensibel auf psychischen Stress reagiert.
- Schwitzen, vermehrte Schweißbildung, vor allem an Händen, Stirn oder Rücken.
- Kurzatmigkeit oder flache Atmung, denn Stress führt zu einer schnellen, oberflächlichen Atmung.
- Muskelverspannungen, oft in Nacken, Schultern oder Rücken, verursacht durch dauerhafte Anspannung.
- Schlafstörungen, Einschlaf- oder Durchschlafprobleme durch kreisende Gedanken.
- Kopfschmerzen, häufig durch Verspannungen oder Schlafmangel bedingt.
- Appetitlosigkeit oder gesteigerter Appetit, Essgewohnheiten ändern sich.
Kognitive Symptome
Auf kognitiver Ebene wirkt sich Prüfungsangst unter anderem auf das Denken, Merken von Lerninhalten und auf die Konzentration aus.
- Konzentrationsstörungen: Die Gedanken schweifen ständig ab.
- Grübeln und kreisende Gedanken.
- Aufmerksamkeitsprobleme: Informationen werden übersehen oder nicht aufgenommen.
- Schwierigkeiten beim Merken von Lerninhalten: Gelerntes bleibt nicht im Gedächtnis.
- Denkblockaden: Das Denken stockt.
- Blackouts in der Prüfung: Auf Wissen kann nicht zugegriffen werden.
Emotionale Symptome
Sämtliche Symptome sind kaum isoliert zu betrachten, sie verstärken sich oft gegenseitig. Wer sich beispielsweise nicht konzentrieren kann, wird nervös, was zu noch weniger Fokus führt. Häufige emotionale Reaktionen sind:
- Nervosität und Anspannung
- Überforderung
- innerer Unruhe
- Reizbarkeit
- Schamgefühlen („Ich bin nicht gut genug“)
- Gefühle von Ohnmacht und Kontrollverlust
- Panikattacken
Bewältigungsstrategien und Tipps zur Prüfungsvorbereitung – Prüfungsangst bewältigen und überwinden
Prüfungsangst sollte nicht verdrängt werden. Ein erster hilfreicher Schritt ist, die Angst anzunehmen, bewusst wahrzunehmen und zu akzeptieren. Es sollte darum gehen, wie man einen konstruktiven Umgang damit entwickelt.

Tipp: Unterstützung bei Prüfungsstress, Zeitmanagement und Lernorganisation gibt es direkt über das Teaching and Learning Center der FH Technikum Wien.
Kurzfristige Strategien
Bleiben Ängste unbeachtet oder werden dauerhaft verdrängt, kann sich die Symptomatik verstärken – in manchen Fällen bis hin zu Panikreaktionen. Kurzfristige Strategien können den Körper wieder entspannen und den Fokus stärken. Etwa:
- Gedankenstopp: Beim Sport heißt es oft „Shake it off“, wenn ein Fehler begangen wird. Das kann wörtlich genommen werden: Negative Gedankenspirale mit einem Ausschütteln oder Fingerschnipsen durchbrechen.
- Atemübungen: Manchmal reicht es schon fünf, sechs Mal tief ein- und wieder auszuatmen. Das signalisiert dem Körper Sicherheit und Ruhe.
- Körperhaltung und Entspannung: Eine aufrechte, stabile Sitzhaltung unterstützt dabei, dem Körper diese Sicherheit und Ruhe zu vermitteln. Des Weiteren kann eine bewusste Lockerung des Körpers durch Selbstmassage oder Ausschütteln dies unterstützen.
- Positive Affirmationen: Bestärkende innere Aussagen wie „Ich bin gut vorbereitet“ helfen, negative Gedanken zu relativieren und das Selbstvertrauen zu stärken.
Langfristige Strategien
Kurzfristige Maßnahmen helfen, akute Angst in den Griff zu bekommen. Um Prüfungsangst jedoch nachhaltig zu reduzieren, ist es sinnvoll, langfristige Strategien in den Studienalltag zu integrieren. Sicher, Nervosität lässt sich nie komplett abschalten und das hat auch etwas Gutes: In Maßen kann sie sogar die Konzentration fördern.
- Kognitive Umstrukturierung: Belastende Gedanken wie „Ich muss perfekt sein“ durch entlastende Überzeugungen ersetzen. Beispielsweise stattdessen sagen: „Eine Drei ist bei der Prüfung in Ordnung.“ Bei dieser Methode sind Geduld und Beharrlichkeit gefragt.
- Zeitmanagement und Lernstruktur: Eine durchdachte Planung mit realistischen Zielen, Pausen und Wiederholungen schafft Sicherheit und verringert das Risiko von Überforderung.
- Bewegung und Sport: Stresssituationen bündeln Energie. Vor allem bei der Prüfungsvorbereitung hilft es, sich auszupowern. Bestenfalls regelmäßig.
- Achtsamkeit und Selbstreflexion: Sich selbst beobachten (Wie bewerte ich die Situation? Welche Gefühle habe ich?) und ehrlich mit sich umgehen, hilft dabei, Muster zu erkennen und zu verändern.
Tipp: Begleitende psychosoziale Beratung kann hier unterstützen um gesunde Lern- und Denkgewohnheiten zu etablieren. Ebenso bietet die Lernberatung eine Unterstützung während des Studiums.
Praktische Lerntipps
- Frühzeitig mit dem Lernen beginnen und Zeitdruck mildern.
- Genügend Pausen einplanen.
- Lerngruppen besuchen und einander helfen. Auch das Wiederholen gelernter Stoffe festigt das Wissen und schafft Sicherheit.
- Lerninhalte auflisten und Gelerntes abhaken. Das schafft Übersicht und Selbstsicherheit.
- Prüfungssituationen mit Probe-Klausuren simulieren.
Wichtig: Um nicht in einen mentalen Tunnel aus Zweifel und Stress zu geraten, können gezielte Gedanken zur Selbststärkung hilfreich sein. Nach dem Prinzip „If in doubt, zoom out“ lohnt es sich, den Blick zu weiten: Sich den eigenen Werdegang und bisherige Erfolge bewusst zu machen, stärkt das Vertrauen in die eigene Kompetenz. Auch ein regelmäßiger Blick auf aktuelle Lernerfolge kann motivierend wirken.
Professionelle Hilfe und Ressourcen bei Prüfungsangst – Therapie, Selbsthilfe und weiterführende Informationen
Wiederkehrende Prüfungs- oder Leistungsängste können sich langfristig verfestigen und das Studium massiv belasten. In solchen Fällen ist professionelle Unterstützung ratsam. Sie bietet nicht nur Hilfe im Umgang mit akuten Belastungen, sondern ermöglicht auch, tieferliegende psychische Ursachen gezielt zu bearbeiten und nachhaltig zu verändern.
Angebot der FH Technikum Wien: Überforderung, Leistungsdruck und Ängste? Studierende der FH Technikum Wien erhalten individuelle Beratung zu Lernstrategien, mentaler Vorbereitung und Prüfungsbewältigung – persönlich oder online buchbar. Somit ist zum einen eine längerfristige Begleitung und zum anderen mit der Kooperation zu Instahelp auch eine psychologische Unterstützung möglich.
Professionelle Unterstützungsangebote:
- Psychologische Beratung & Psychotherapie: Viele Hochschulen und Studierendenwerke bieten psychologische Beratung kostenlos oder kostengünstig an. Bei stärkeren Belastungen wie Panikattacken oder depressiven Symptomen kann eine Psychotherapie hilfreich sein. Etwa in Form von Verhaltenstherapie oder systemischer Therapie.
- Coaching und Lernberatung: Spezialisierte Angebote unterstützen bei Zeitmanagement, Prüfungsorganisation, Stressbewältigung und Präsentationstrainings.