ZIRBE (Stadt Wien Kompetenzteam für Zirkuläres Bauen)
Um den steigenden Ressourcen- und Energieverbrauch im Sektor „Bauwirtschaft und Gebäude“ und die daraus resultierenden Abfälle und einhergehende ökologische Belastung durch Emissionen in Luft, Wasser und Boden zu verringern, wird eine fundamentale Transformation von der linearen Wirtschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft in den Entwicklungsstrategien der Stadt Wien genannt. Darüber hinaus werden sogenannte frugale Lösungen in der angewandten Forschung diskutiert, die sich durch Ressourcenschonung und eine geringe Komplexität auszeichnen.
Digitale und automatisierte Technologien können die Umsetzung verschiedener
kreislauforientierter Strategien in Hinblick auf Neubau, Umbau und Sanierung eines Gebäudes unterstützen. Konkrete Beispiele für autonome bzw. automatisierte robotische Systeme sind
a)automatisierte Produktion zur Optimierung von Prozessen und Verringerung des Rohstoffeinsatzes,
b) additive Fertigung von Bauteilen mit recylierbaren Materialien vor Ort,
c) robotergestützte
Montageprozesse,
d) der zerstörungsfreiere Rückbau von Gebäudeteilen, um die Wiederverwendung
von Re-Use-Bauteilen zu ermöglichen, und
e) die automatisierte Sortierung von eingesetzten
Materialien, um Recycling-Prozesse effizienter zu gestalten.
Für Zirkularitätsbewertungen von Bauteilen und Systeme sind außerdem umfassende Kenntnisse über Komponenten, Materialien, Inhaltsstoffe und chemischen Substanzen, sowie Details zur Reparierbarkeit, Ersatzteilverfügbarkeit und fachgerechten Entsorgung eines Bauteiles erforderlich. Mit Hilfe von digitalen Systemen können Live-Daten über den gesamten Lebenszyklus hinweg bereitgestellt werden.
Im Sinne einer nachhaltigen (Stadt)Entwicklung ist es notwendig die jeweiligen Konzepte zum zirkulären Bauen auf ihre ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen hin zur überprüfen und allenfalls hinsichtlich notwendiger Verbesserungen zu adaptieren. Hierzu ist eine, die Entwicklungsprozesse begleitende, umfassende Technikfolgenabschätzung (Comprehensive Constructive Technology Assessment) mit unterschiedlichen Methoden wie consequential Life Cycle Assessment (LCA) oder social LCA eine geeignete Vorgangsweise. Die Einbeziehung von Akteur*innen und Betroffenen in die Gestaltungprozesse bietet die Möglichkeit unterschiedliche Lebenswelten der Betroffenen zu antizipieren und in den Planungs- und Designprozess einzubeziehen.
Die Umstellung auf zirkuläres Wirtschaften stellt eine interdisziplinäre Herausforderung dar. Ein wirksames Design für eine Kreislaufwirtschaft erfordert einen integrativen Forschungsansatz, der die Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche wie Gebäudetechnik, und im Sinne der „Triple Transition“ – digitale Datenerfassung und -auswertung, automatisierte Lösungen, sowie die Analyse von ökologischen und sozialen Auswirkungen vereint.
Im Projekt ZIRBE steht eine ganzheitliche Entwicklung von frugalen und kreislauforientierten Konzepten zu zirkulärem Bauen im Fokus. Aufbauend auf den vorhandenen Kompetenzen der Fakultät „Industrial Engineering“ soll das Projekt digitale und Automatisierungs-Kompetenzen, Umweltbewertungs- und sozialwissenschaftliche Kompetenzen in der Technikfolgenabschätzung gezielt ausbauen und anhand von Demonstrationsprojekten die Kompetenzen vertiefen. Die Fach-, Methoden- und interdisziplinären Kompetenzen werden in Forschung und Lehre an der FH Technikum Wien verankert. Anhand von jährlichen Workshops, mit dem Ziel den regelmäßigen
Austausch zwischen Forschung, Unternehmen und der Stadt Wien zu ermöglichen, soll ZIRBE einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der Wiener Klimaziele leisten.

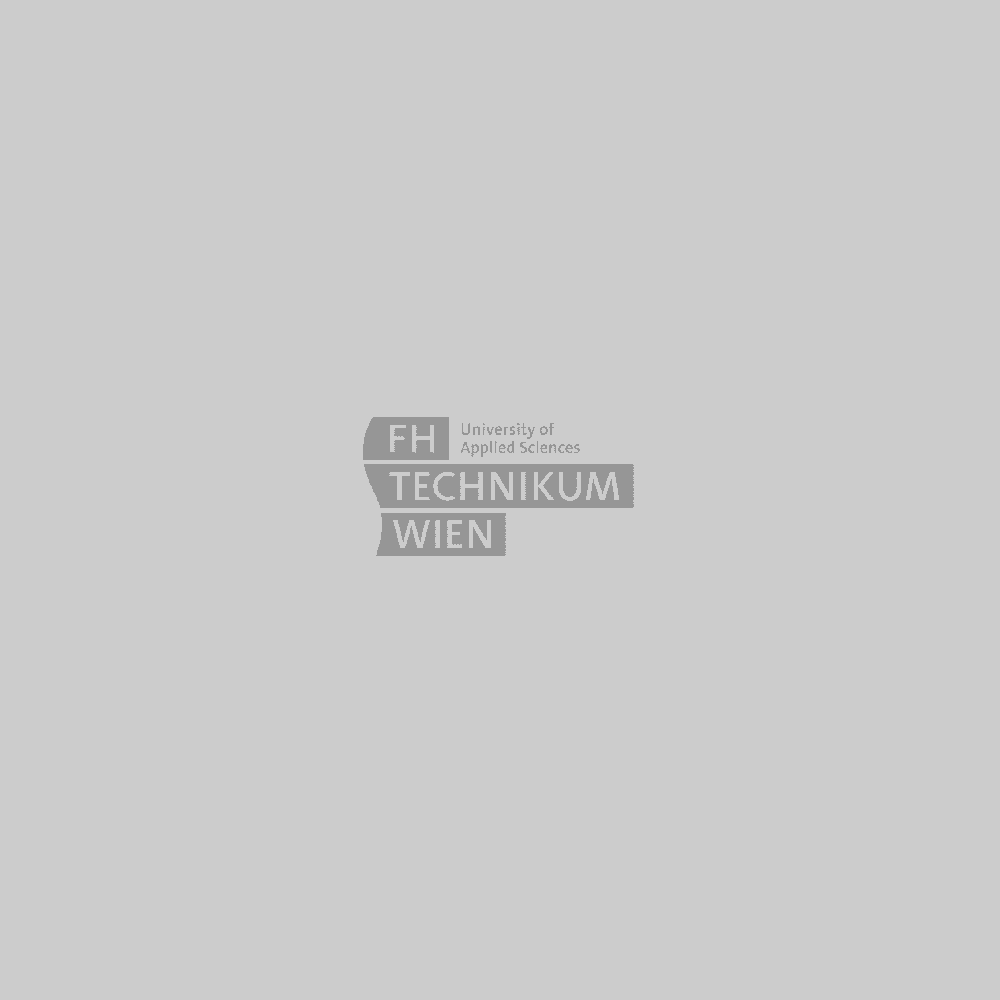
Lecturer/Researcher
Team und Besetzung:
Projektleitung:
- Natalie Taupe
Projektmitarbeiter:
- Daniel Bell